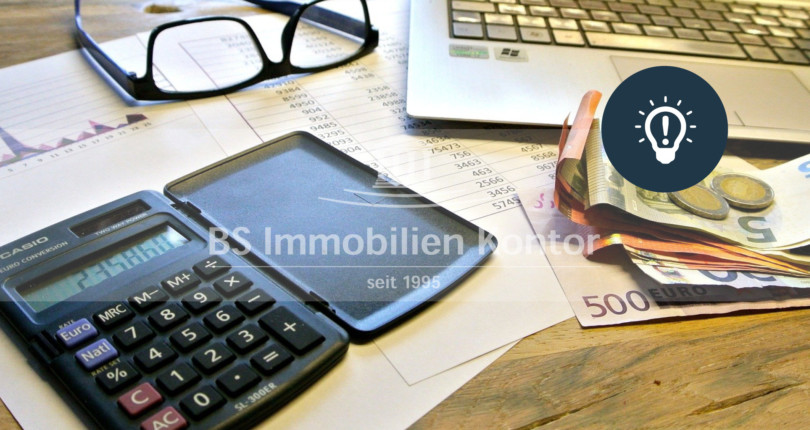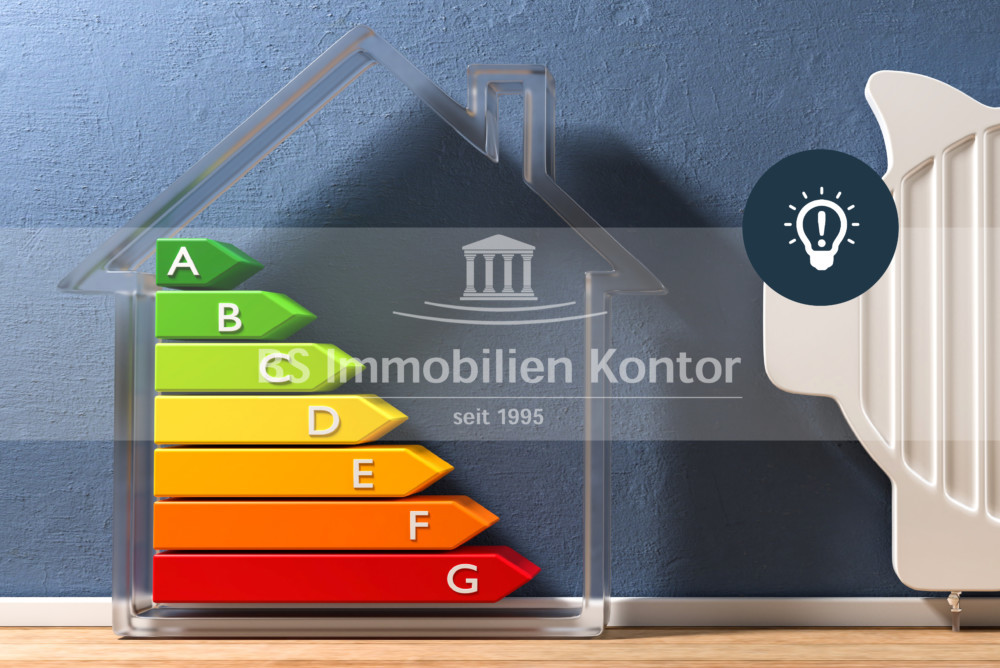Vorfälligkeitsentschädigung
Vorfälligkeitsentschädigung ist diejenige Entschädigung, die ein Kreditnehmer der Bank zahlen muss, wenn er sein Hypothekendarlehen vorzeitig kündigt. Will ein Eigentümer seine Immobilie verkaufen, kann es sein, dass dieses Thema relevant wird. Eine Vorfälligkeitsentschädigung entfällt nur dann, wenn der Hypothekendarlehensvertrag nach Ablauf von zehn Jahren mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt wird (§ 489 Abs. I Nr. 2 BGB). Teils erweisen sich aber auch die Widerrufsbelehrungen der Banken als fehlerhaft, mit der Konsequenz, dass der Darlehensnehmer den Kreditvertrag widerrufen und das Hypothekendarlehen zurückzahlen kann, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Vor Ablauf von zehn Jahren steht dem Darlehensnehmer nur ausnahmsweise ein Kündigungsrecht zu, wenn er ein berechtigtes Interesse vorträgt und seit der Auszahlung des Darlehens sechs Monate vergangen sind (§ 490 Abs. II BGB). Als berechtigtes Interesse erkennt das Gesetz ausdrücklich an, wenn der Darlehensnehmer seine Immobilie verkaufen möchte. Ob er sich dazu aus privaten oder beruflichen Gründen veranlasst sieht, spielt keine Rolle. Kündigt er, hat die Bank Anspruch auf eine Vorfälligkeitsentschädigung (§ 490 Abs. II S. 3 BGB). Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung Will der Darlehensnehmer im Hinblick auf ein sinkendes Hypothekenzinsniveau im Einvernehmen mit der Bank sein Darlehen vorzeitig umschulden, muss er kalkulieren, inwieweit eine Vorfälligkeitsentschädigung den Zinsvorteil möglicherweise zunichte […]